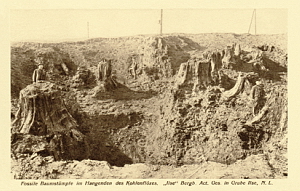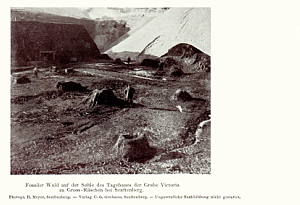|
|
Themenwechsel! Von Braunhemden zu Braunkohle 
Die Klammer um die drei heute vorzustellenden Ansichtskarten ist die erstaunliche Entwicklungsgeschichte der heimischen
Braunkohle bzw. die Dinge, die den Prozess der Kohlewerdung teilweise veranschaulichen. Gemeint sind die fossilen planzlichen
Überreste, die man teilweise auch heute noch im Tagebau finden kann. Die Postkartenhersteller der Jahrhundertwende fanden diese
offensichtlich so bemerkenswert, dass sie eine ganze Reihe unterschiedlicher Motive dieser Art auflegten.
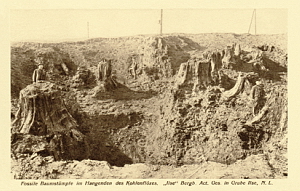
Kupfertiefdruck der Fremdenblatt-Druckerei, Hamburg
Aufnahme <= 1913
Sammlung Erika Fischer
|
Das links abgebildete Motiv kann auf <= 1913 gedeckelt werden. Die Aufnahme tauchte
neben einer ganzen Reihe weiterer Abbildungen dieser Art in der Chronik zum 25-jährigen
Bestehen der Ilse-Bergbau AG auf. Dies erfolgte zur Illustration eines ganzen Kapitels,
verfasst vom Geh. Bergrat Prof. Dr. Keilhack. Der mit Die geologischen Verhältnisse
des Niederlausitzer Braunkohlengebietes mit besonderer Berücksichtigung der Felder der
Ilse Bergbau-Actiengesellschaft in Grube Ilse betitelte Beitrag, schildert auf 45
Seiten die Bedingungen und Vorgänge, die dazu führten, dass unsere Heimatregion mit diesem
unvorstellbar riesigen Vorrat Braunkohle ausgestattet wurde.
Keine Angst, ich habe nicht vor, diese wissenschaftlichen Abhandlung zu zitieren, sondern
verwende stattdessen einen etwas populärwissenschaftlicheren Text. Doch dazu später.
|
Die beiden restlichen Motive entstammen ohne Zweifel einer Serie von Aufnahmen. Sie wurden an
der selben Stelle zeitgleich, nur mit leicht unterschiedlichem Winkel aufgenommen. Die anwesenden
Personen wurden dazu etwas umpositioniert aber der Rest stimmt überein. Die linke Bildvariante kennen
wir schon von dieser "verrückten" Karte mit dem Stück Sumpfzypresse.
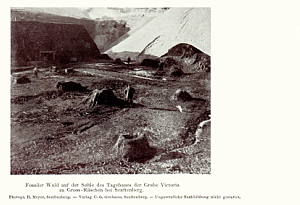
Photogr. H.Meyer, Senftenberg. -
Verlag C.G.Grubann, Senftenberg. -
Ungesetzliche Nachbildung nicht gestattet.
Aufnahme <= 1901
Sammlung Fred Förster

|

Verlag: Alfred Kratze, Chemnitz
1909
Aufnahme <= 1901
Sammlung Norbert Jurk
|
Die rechte Abbildung indes schaffte es 1906 in einer modifizierten Version in Ferdinand Hirts Lesebuch für Brandenburg
für mehrklassige evangelische Schulen. Besagtes Werk vereinigt eine ganze Reihe von Texten und Gedichten zur Verwendung im
Unterricht des 6. - 8. Schuljahrs. Den Text, der durch die Abbildung illustriert wurde, möchte ich nachfolgend in Gänze wiedergeben,
da er hervorragend zu den heutigen Motiven passt, was nicht zuletzt durch die erwähnte Verwendung einer der Abbildungen belegt
wird.
In den Senftenberger Braunkohlenbergwerken.
1. Die Mark Brandenburg wurde ehemals des heiligen römischen
Reiches Erzstreusandbüchse genannt. Diesen Namen verdient
sie aber durchaus nicht. Sie ist nicht nur an Naturschönheiten
reich, sondern birgt im Schoße ihres geschmähten Sandes auch
Schätze, deren Hebung zahlreichen Bewohnern den Lebensunterhalt
verschafft. Der Süden der Provinz ist reich an Kohlenlagern, die
sich in einem Umfange von ungefähr 100 Quadratkilometern um
die Stadt Senftenberg ausdehnen. In wenigen Stunden führt uns
das Dampfroß von der Hauptstadt über Lübbenau und Calau nach
Groß-Räschen. Nach kurzer Wanderung gelangen wir an den Rand
des großen Braunkohlenfeldes, und bald tauchen die hohen
Fabrikschlote des Braunkohlenbergwerks "Viktoria" vor uns auf.
Wir sind am Ziele.
2. Nachdem wir die Erlaubnis zum Eintritt in die Grube erhalten
haben, folgen wir dem Schienenwege, der von der Brikettfabrik
dorthin führt, und stehen bald am Rande eines gewaltigen Kessels,
dessen Wände aus dunkler Braunkohle bestehen. Die über der
Kohle lagernden Kies-, Sand- und Tonmassen werden durch
Trockenbagger oder durch Handbetrieb abgeräumt. Lange Züge
von Wagen, die mit diesem "Abraum" beladen sind, bewegen sich
unausgesetzt am gegenüberliegenden oberen Rande der Grube.
Ihr Inhalt wird zum Ausfüllen der bereits abgebauten Teile
des Kohlenlagers verwendet. Aus dem guten Ton, der an manchen
Stellen über der Kohle lagert, werden in gewaltigen Ringöfen
Klinker und Verblendsteine gebrannt. Allein die Ziegeleien der
Braunkohlenwerke "Viktoria" liefern davon jährlich etwa 12
Millionen Stück.
In der Tiefe sehen wir einige Dutzend Arbeiter, die in dem
weiten Raume fast verschwinden, mit dem Abbau beschäftigt.
Der Bergmann arbeitet hier nicht im dunklen Schoß der Erde
beim trüben Licht der Grubenlampe, sondern die Kohle wird
von obenher im "Tagbau" gewonnen. Nur wo der Abraum eine
Mächtigkeit von mehr als 15 Meter hat, wird die Kohle durch
"Tiefbau" gewonnen, da sich die Kosten der Entfernung des
Abraums hier zu hoch stellen würden.
|
3. Auf steiler Treppe steigen wir auf den Boden der Grube hinab,
der von einem Schienennetz durchkreuzt wird. Unsre Aufmerksamkeit
wird vor allem durch eine Anzahl braunkohlenähnlicher, aber
heller gefärbter Stümpfe von gleicher, etwa ein Meter betragender
Höhe gefesselt. Wir sehen hier die Reste gewaltiger Baumriesen
so gut erhalten, daß man noch den Verlauf der Holzfasern erkennen
und die Jahresringe zählen kann. Die Stümpfe haben einen Durchmesser
von 2 bis 3 Meter, und auf dem dicksten derselben können 20
Personen nebeneinander stehen. Andre, leider schon verschüttete
Stämme sollen noch stärker gewesen sein. Die Stämme sind sämtlich
an Ort und Stelle gewachsen. Dafür spricht nicht nur die aufrechte
Stellung der Stümpfe und der Verlauf ihrer Wurzeln im Tonboden,
der das "Liegende" des Kohlenlagers bildet, sondern auch der
Abstand der ehemaligen Stämme voneinander. Er entspricht dem
Raume, den sich Urwaldbäume im Kampf ums Dasein noch heute zu
schaffen pflegen. Dieselbe Art der Bäume, die hier vor Jahrtausenden
durch ihren Untergang die Kohle bilden halfen, grünt noch heute
im südlichen Nordamerika.
Treten wir aus der Mitte der Grube näher an die senkrecht aufsteigende
Wand des 15 bis 30 Meter mächtigen Kohlenlagers, so erblicken wir
sowohl auf der Oberfläche wie inmitten des Flözes dasselbe Bild:
aufrechte, noch bewurzelte Baumstümpfe nebst den dazugehörigen
angebrochenen Stämmen, von denen die Hacke des Bergmanns oft
lange, deutlich erkennbare Holzscheite losgerissen hat. Die
Kohle ist also aus Pflanzen entstanden, die an Ort und Stelle
gewachsen sind. Die Ansicht, daß zu ihrer Bildung ungeheure Anhäufungen
zusammengeschwemmten Holzes gedient haben, ist nicht richtig.
Es handelt sich vielmehr um ein mächtiges Waldmoor, das sich hier
einst befunden haben muß.
|

|
4. Vor vielen tausend Jahren zog sich das Meer, das bis dahin
den Boden Norddeutschlands bedeckt hatte, allmählich nordwärts
in seine gegenwärtigen Grenzen zurück. Hier und da blieben jedoch
in Vertiefungen des Bodens seichte Buchten und abflußlose Wasserbecken
zurück, die allmählich versumpften und durch Pflanzen aus den
umliegenden Landstrichen besiedelt wurden. So entstanden allmählich
riesige Sumpfwaldungen. Über einem üppigen Untergrunde, durch die
feuchtwarme Luft des damaligen Klimas in ihrem Wachstum mächtig
gefördert, breiteten Nadelhölzer, insbesondere Sumpfzypressen, stolz
ihre umfangreichen Kronen aus. Sie waren wie unsre Lärchen nicht
immergrün und bedeckten alljährlich einmal die Oberfläche des
Sumpfes mit den absterbenden Nadeln und Zweigen. Mit diesen
vermoderten Teile von Laubhölzern und kleineren Pflanzen und
bildeten die Hauptmasse der späteren Braunkohle. Jahrtausende
hindurch ragten die Nadelbäume, noch von keinem Menschenauge
bewundert, als die Fürsten des Waldes in ungestörtem Frieden über
das vergänglichere Volk der niederen Gewächse empor. Endlich aber
erlosch auch die Lebenskraft dieser Riesen, besonders wohl, weil
sich das Klima änderte. Von dem zusammenstürzenden Baumgreisen
blieben nur die von Wasser umgebenen, vor Verwesung geschützten
Stümpfe erhalten, während die Stämme schnell vermoderten, sofern
sie nicht ebenfalls durch Windbruch u. dgl. ins Wasser geraten waren.
Wagerecht liegende Baumreste in allen Schichten des Kohlenlagers,
Stammstücke bis zu einer Länge von mehr als 20 Meter, geben Kunde
von den gestürzten Teilen jener Baumriesen. Wie in jedem Urwalde,
so erstanden auch hier auf den Resten der abgestorbenen Pflanzenwelt
immer neue Geschlechter von Bäumen, die, gleich jenen absterbend
und im Sumpfe versinkend, durch einen unter Luftabschluß im Moore
ungestört verlaufenden Verkohlungsprozeß im Laufe vieler Jahrtausende
das Material der jetzt vorhandenen Kohlenlager bildeten.
5. Die im Senftenberger Revier geförderte Kohle läßt
sich wegen ihres hohen Wassergehalts, der etwa 50 Prozent beträgt,
nicht ohne weiteres verfeuern.
|
Sie wird deshalb in Fabriken, die mit den einzelnen Gruben durch
Schienenstränge verbunden sind, zu Briketts verarbeitet. Die Förderwagen
schaffen das Material zunächst in die Sortierhäuser, wo es zerkleinert,
gesiebt und von den nicht verkohlten Holzresten befreit wird. Während
die letzteren zur Kesselfeuerung benutzt werden, wandert die in 1 bis 1½
Kubikzentimeter große Stücke zerkleinerte Kohle in die oberhalb des
Trockenraums liegenden Kohlenböden. Von hier gelangt sie in ununterbrochenem
Zuge auf die Trockenöfen, große schmiedeeiserne Pfannen mit doppeltem
Boden, auf deren oberer Platte ein Rührwerk kreist. Hier wird die Kohle
von drei Vierteln ihres Wassergehalts befreit, nochmals gesiebt, gewalzt
und gereinigt. Anstatt der Teller bedient man sich neuerdings auch großer,
schmiedeeiserner Trommeln zum Trocknen der Kohle. Dieselben haben eine
schräge Stellung und werden von etwa 300 eisernen Röhren durchzogen, die
von heißem Dampf umspült werden. Die Kohle fällt von obenher feucht in
diese Röhren hinein, um sie unten getrocknet zu verlassen. Durch Maschinen
wird die Kohle aus dem Sammelraum nun der Presse zugeführt. Eine Walze schiebt
genau so viel Kohlenstaub, wie zu einem Brikett nötig ist, in die
Form, und der mit der Fabrikmarke versehene Stempel preßt ihn unter
gewaltigem Druck ohne jedes Bindemittel zu einem festen Stück zusammen.
6. Auf dem Wege nach Senftenberg haben wir noch weitere
Ausblicke auf die grubenreiche Umgebung. Zu beiden Seiten der Straße
sind gewaltige Strecken des Kohlenlagers im Verlaufe der noch ziemlich
kurzen Zeit des hiesigen Bergbaus ausgebeutet und mit den Abraummassen
wieder ausgefüllt worden. Wir sehen die hohen Essen der Anhaltischen
und Henkelschen Kohlenwerke, der Grube "Ilse" u.a.m. Die jährliche
Förderung der gesamten Braunkohlenwerke der Niederlausitz beträgt jetzt
über 143 Millionen Hektoliter. Es sind 225 Pressen aufgestellt, die
jährlich ungefähr 3 Millionen Tonnen, d.h. 300000 Waggonladungen
Briketts anfertigen, deren Hauptabnehmer die Millionenstadt Berlin ist.
|
|
|
|
Vor zwei Tagen versprach ich, nochmals auf Hieronymus Wieciers zurückzukommen und dieses Versprechen möchte ich nun einlösen.
Ausgangspunkt ist sein "Auftauchen" auf einer weiteren Fotopostkarte, nämlich folgender...

Aufnahme = 01.05.1933
Sammlung Georg Messenbrink
|
Anlass und Zeitpunkt des hier abgelichteten Aufmarsches waren lange Zeit ungewiss.
Beim Hin- und Herüberlegen fielen mir zwei weitere Aufnahmen in die Hände, die
offensichtlich die selbe Demonstration zeigen, nur eben mit jeweils anderen Akteuren.
Die Bildunterschriften verraten es natürlich. Es ist der 1.Mai 1933 und es ist zweifelsfrei
die Mai-Demonstration, die man damals noch "Umzug" nannte.
|

Aufnahme = 01.05.1933
Sammlung Fred Förster
|

Aufnahme = 01.05.1933
Museen OSL
|
|
Theoretisch hätte es aber auch der 1.Mai 1934, 1935 usw. usf. sein können. Ist es aber nicht! Der Grund?
Hieronymus Wieciers, oder genauer gesagt: seine Armbinde! Erika Fischer wies mich darauf hin und lieferte mir
weitere Hintergrundinformationen zum Arbeiter-Samariter-Bund (die Armbinde ist die des A-S-B), die ich durch weitere
Recherche bestätigt fand. Der 1888 gegründete Arbeiter-Samariter-Bund fiel mit der Machtergreifung Hitlers 1933
dem Verbot „marxistischer Organisationen“ zum Opfer, politisch aktive Mitglieder wurden verfolgt. Das Bundeseigentum
wurde dem DRK, den SA- oder SS-Sanitätseinheiten zugeschlagen. Ein Großteil der Mitglieder wurden in das Deutsche
Rote Kreuz eingegliedert und versah dort weiterhin seinen Dienst. Die "Abwicklung" des A-S-B erfolgte in ganz
Deutschland zwischen Mai und Juli 1933. Ab August war der Bund verboten.
|
Dies kann man auch sehr schön an den geklebten
Marken in H.Wieciers Mitgliedsbuch nachvollziehen.
Der letzte Beitrag wurde im Mai 1933 erhoben und
durch die entsprechende Marke bestätigt. Danach war
"Schluß mit lustig".
Das bedeutet, dass wir auf dem ersten Foto wahrscheinlich
seinen letzten Einsatz als A-S-B- Mann und eine der
seltenen Gelegenheiten sehen, wo Hakenkreuz- und ASB-
Armbinden einträchtig nebeneinander abgebildet sind.
Die heutige Geschichtsstunde ist jedoch noch nicht zu
Ende!
Auf Bild 2 links unten sehen wir an der Spitze des
Senftenberger Magistrats, den damaligen Bürgermeister
Legau. Hinter ihm die Standarte mit der Aufschrift
N.S.B.O. Magistrat Senftenberg. Wer die Abkürzung
N.S.B.O. bislang noch nicht kannte muss sich nicht schämen.
Auch mir war sie bisher nicht geläufig.
N.S.B.O. = Nationalsozialistische Betriebszellenorganisation
Geschichte und Zweck dieser Organisation kann man
hier nachlesen.
Dort erfahren wir auch, dass die N.S.B.O. im Jahre 1935
vollständig in der D.A.F. aufgang. Deshalb könnten die
Aufnahmen also maximal aus jenem Jahr stammen.
Wie ich jedoch herausgearbeitet habe, können wir sicher
sein, dass es sich um den 1.Mai 1933 handelt. In diesem
Zusammenhang möchte ich auf einen Umstand hinweisen, der
noch auf Klärung wartet. Sämtliche Ausgaben des Senftenberger
Anzeiger aus dem ersten Halbjahr 1933, somit auch für
den Zeitraum der heute vorgestellten Bilder, sind komplett
aus den Archiven vor Ort verschwunden... Giftschrank?
Aus diesem Grund kann ich auch keine Faksimiles für den
Mai 1933 liefern. Dafür aus dem nachfolgenden Jahr. Die
Unterschiede dürften marginal ausgefallen sein...
|

|

Senftenberger Anzeiger (1934)
|
|