|
|

Verlag von G.R.Ziethe, Senftenberg.
8384
Aufnahme <= 1900
Sammlung Norbert Jurk


Ausgerechnet die qualitativ schlechteste der drei
heutigen Produktionen bildet den inhaltlichen
Mittelpunkt. Während wir die beiden Motive rechts
und links schon seit langem kennen und die heute
dargebotenen Varianten keinen großen Erkenntnisgewinn
bieten, ist die Nachkriegsproduktion in der Mitte
des Trios tatsächlich nicht ganz uninteressant.
Doch schnell noch zu den Ansichten aus der Zeit der
Jahrhundertwende: Das linke Exemplar empfinde ich
als sehr schön aufgemacht. Das Maximum an Bildinformationen
zu diesem Blick in die Moritzstraße bietet aber
leider immer noch ausgerechnet die Mini-Variante
mit dem floralen Zusatz.
|

M.Karich, Buchhandlung,
Senftenberg
9008
(M 306) 10212 Z 8437
Nr. 11277
Aufnahme <= 19??
Sammlung Fred Förster

|
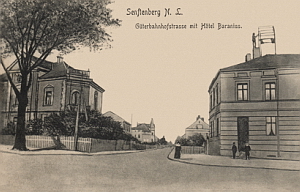
Photographie und Verlag Wilhelm Brückner, Senftenberg
R. 6624
Aufnahme <= 1905
Sammlung Matthias Gleisner

Zwar ein qualitativer Fortschritt gegenüber der
ersten archivierten Version aber dennoch kommt
mir persönlich die Darstellung immer noch zu
sehr "gemalt" rüber. Zweifellos gab es eine echte
fotografische Vorlage der Szenerie, aber die
Personen waren wahrscheinlich komplett eine
Erfindung des Ansichtskarten-Herstellers. Allein
die Proportionen sprechen dafür.
Wir warten weiter auf einen weniger manipulierten
Blick in die Güterbahnhofstraße!
|
|
Aber nun wie versprochen zum mittleren Stück, welches uns zeitlich knapp 50 Jahre weiter in Richtung Gegenwart versetzt. Es handelt sich
um einen weiteren Teil der Serie, die von der Buchhandlung Karich herausgegeben wurde. Wann genau die Veröffentlichung stattfand ist
immer noch etwas unklar, da die meisten Exemplare, die mir bislang vorlagen, nicht postalisch gelaufen sind. Ich vermute jedoch
1949/50.
|

|
Zwei Dinge sind auf dem Motiv interessant. Zunächst die kleine Tankstelle links. Diese existierte an genau derselben Stelle schon
Mitte der 1930er Jahre und sah damals nicht wesentlich anders aus. Ein Unterschied war aus meiner Sicht jedoch, daß die Kunden ihr
Fahrzeug nicht auf die hier dargestellte Weise betanken konnten, sondern ausschließlich in Fahrtrichtung. 1935 verhinderte noch ein
Grünstreifen das Ansteuern der Zapfsäulen auf die hier abgebildete Art. Möglicherweise war die Szene auf der Ansichtskarte aber auch
nur ein wenig gestellt. Ich würde behaupten, daß im Verlauf des II. Weltkrieges und der damit verbundenen Verknappung und Rationierung
von Benzin, privat betriebene Tankstellen zunehmend aus dem Verkehr gezogen wurden. So auch die Zapfanlage in der Bahnhofstraße 50.
Und auch nach Kriegsende ging es mit der Versorgung der wenigen Fahrzeuge, die den Krieg heil überstanden hatten, nicht sofort wieder
aufwärts. Kurt Bode gab erst Ende August 1947 die Wiedereröffnung der Tankstelle bekannt. Aus dieser Zeit stammt auch das unten abgebildete
Inserat aus einem Firmen-Verzeichnis, welches neben der Haupteinnahmequelle Bodes, nämlich des Lebensmittelhandels, auch auf den Vertrieb
von Benzin und Schmierstoffen verweist.
|
|
|

|
Die zweite interessante Sache ist das im Hintergrund abgebildete Gebäude, welches heutzutage (und das schon seit mindestens 15 Jahren) zum Kauf
angeboten wird, und gemeinhin als "TRAPO" bekannt ist. Zu Zeiten der Ansichtskartenproduktion lief das Ganze noch unter Volkshaus. Die
Historie des Gebäudes begann im Oktober 1933 mit der Inbetriebnahme als Gaststätte und Hotel unter dem Namen Thüringer Hof. So ein
richtig gutes Händchen muß der Betreiber Karl Kunze dabei jedoch nicht gehabt haben, denn Ende der 1930er avancierte das Haus mehr und mehr
zur Zentrale diverser nationalsozialistischer Organisationen. In der Moritzstraße 1 befanden sich zunächst die Dienststellen der Hitlerjugend (HJ)
und des Bundes Deutscher Mädel (BDM). Ab spätestens 1940 beherbergte das Haus auch die NSDAP-Kreisleitung des Kreises Calau. Nach dem Krieg
wechselten zwar die politischen Machthaber und ebenso der Betreiber (Friedrich Deffke) aber ein Gaststätten- und Hotelbetrieb wurde an dieser
Stelle wohl nur halbherzig aufgenommen.

Wie man der Anzeige entnehmen kann, wurde der Name "Thüringer Hof" in "Volkshaus" geändert und der Verweis auf die zur Verfügung stehenden
Versammlungsräume zeigte die unveränderte Ausrichtung als Stützpunkt politischer Organisationen. Eine "Arbeiterpartei" (NSDAP) überreichte
sinnbildlich der nächsten (SED) die Büroschlüssel!

|

Spätestens 1949 durften auch zwei weitere "Blockparteien", nämlich
die CDU und die LDPD ihre Lager im Volkshaus aufschlagen. Wie man
links abgebildeten Faksimile aus der "Lausitzer Rundschau" des Jahres
1986 entnehmen kann, erfolgte 1946 in dem Haus auch die Gründung der
Ortsgruppe der Freien Deutschen Jugend (FDJ). Ihren Sitz hatte selbige
jedoch in einer Baracke am Dubinaweg 1.

|
|