|
Das Feuerlöschwesen im Niederlausitzer Bergbaubezirk
aus: "Der Niederlausitzer Braunkohlenbergmann" (1926)
|
In jedem Braunkohlenrevier, wie z.B. in der Niederlausitz, dem
größten Revier in ganz Mitteldeutschland, muß der Bekämpfung von
Bränden ganz besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Diese Brände
werden, abgesehen von den durch besondere Umstände hervorgerufenen
Gebäudebränden, meistens dadurch verursacht, daß namentlich in der
heißen Jahreszeit die freigelegte und ausgetrocknete Kohle durch
irgendwelche Ursachen, wie Funkenflug oder Unachtsamkeit in Brand
gerät. Hiergegen suchen sich bekanntlich die Werke zu schützen
durch umfangreiche Wasserrohranlagen, aus denen sofort irgendein
auf der Kohlenoberfläche entstandener Brand gelöscht werden kann.
Nimmt jedoch der Brand durch Wind oder Sturm eine größere Ausdehnung
an, genügen die zur Berieselung vorhandenen Wasserleitungen nicht,
so ist es unbedingt notwendig, sofort durch Feuerlöschmittel den
Brand niederzukämpfen, um einen Stillstand in der Kohlengewinnung
und somit einen Produktionsausfall zu vermeiden.
In der Niederlausitz, im Bereich des Bergbauvereins, beschaffte man
zunächst zum Feuerlöschen eine Dampfspritze, die vom Jahre 1906 bis
zum Jahre 1920 mit sehr gutem Erfolge im Betrieb war, jedoch mit
der Zeit wegen dauernder Reparaturbedürftigkeit und zu langsamer
Dampf- und Druckentwicklung bei den immer umfangreicheren Tagebauanlagen
nicht mehr genügte.
Es lag daher nahe, diese alte Dampfspritze durch moderne Motorspritzen
zu ersetzen, die bekanntlich in kürzester Zeit betriebsfähig sind.
Im Jahre 1920 beschlossen diejenigen der beim Niederlausitzer
Bergbauverein in einer Spritzengemeinschaft zusammengeschlossenen
Braunkohlenwerke die Anschaffung einer vierrädrigen Motorfeuerspritze,
die von der Fa. Koebe in Luckenwalde geliefert wurde und erstmalig
als Modell "Bergbau" mit einer Leistung von 1200 Liter pro Minute
bei 6 Atm. Druck in Anwendung kam. Die Zentrifugalpumpe dieser Spritze
war mit dem vierzylindrigen Motor (13/40 PS N.U.S.) direkt gekuppelt,
wobei die Saugvorrichtung durch eine Handpumpe getätigt wurde. Diese
Spritze bewährte sich, bereits am Tage ihrer Abnahme zur Bekämpfung
eines Tagebaubrandes auf Grube Henriette ausprobiert, aufs beste, so
daß die Spritzengemeinschaft auf Vorschlag ihrer technischen Kommission
im folgenden Jahre die Anschaffung einer zweiten vierrädrigen Motorspritze,
ebenfalls Modell "Bergbau", von der Firma Koebe in Luckenwalde um so
mehr beschloß, als sich herausstellte, daß in der heißen Jahreszeit
in dem augedehnten Revier mit 45 Werken eine Spritze allein bei weitem
nicht ausreichte. Als Vorteil gegenüber der ersten Spritze hat die
zweite vor allem die automatisch (selbsttätig) wirkende Ansaugervorrichtung
aufzuweisen. Beide Spritzen haben eine Leistung von je 1200 Liter pro
Minute oder 1400 Liter bei freiem Auslauf.
Es kam das Jahr 1922 mit seinen zahlreichen Tagebaubränden, mit jener
Schreckenswoche im Juli, wo es auf einem halben Dutzend Gruben allein im
Senftenberger Revier brannte, die beiden Motorspritzen allein bei
weitem nicht ausreichten und man sogar die Berliner und Dresdener Feuerwehr
zu Hilfe rufen mußte.
|
|
Der Senftenberger Anzeiger meldete am 7.Juli 1922 dazu, daß infolge
der tropischen Hitze (das Thermometer zeigte gestern 42 Grad) die Tagebauten
der Grube Bertha und Grube Friedrich Ernst in Brand geraten seien. Auch
Grube Heye soll in Brand stehen. Ebenso gelangten auch Mitteilungen über
Grubenbrände bei Dobristroh nach hier.
Am 11. Juli berichtete die selbe Zeitung daß das Feuer, das vor einigen
Tagen durch Selbstentzündung von Braunkohlenstaub auf dem Tagebau der Grube
Marie III der Braunkohlengesellschaft Ilse zum Ausbruch gekommen ist, dadurch
eine außerordentlich große Ausdehnung erfahren hat , daß ein einsetzender
Wirbelsturm die glimmenden Teile des an und für sich ungefährlichen Entzündungsherdes
angefacht und auf andere Gruben übertragen hat. Der Tagebau Marie III brannte
in seiner vollen Ausdehnung auf 1 Kilometer Länge und 500 Meter Breite. Hier kamen
die bereits erwähnten Wehren aus Berlin und Dresden zum Einsatz.

|
40601
Verlag: A.Agotz, Dresden,
Pfotenhauerstr.27
Aufnahme = 07.1921
Sammlung Kurt Thiel
|
In jenem Juli 1922 wurde der Tagebau "Meurostolln" nicht in Mitleidenschaft gezogen.
Ihn erwischte es ein Jahr zuvor:
- Senftenberg, 21.Juli. Das Emporsteigen gewaltiger Rauchschwaden kündete gestern
nachmittags bei dem starken Sturm einen größeren Grubenbrand an, und bald darauf
ertönte der Feueralarm. Der Tagebau der Grube Meurostollen, unweit des Wasserturmes,
war durch Abbröckeln größerer, glimmender Kohlenmassen in Brand geraten. Die
Motorspritze und die Feuerwehren der umliegenden Ortschaften waren bald zur Stelle
und trotz aller Bemühungen ist es bisher noch nicht gelungen, Herr des gewaltigen
Elementes zu werden. Alle umliegenden Bewohner hatten sehr unter dem ausströmenden
Rauch zu leiden. Ebenso war der Tagebau der Grube der Anhaltischen Kohlenwerke in
Brand geraten. Die Rettungsarbeiten gestalten sich auch dort sehr schwierig. Größere
Dimensionen nahmen die Brände infolge des herrschenden Sturmes an.
Obwohl die abgebildete Ansichtskarte keinen Datumsvermerk trägt und auch postalisch
nicht gelaufen ist, gehe ich fest davon aus, daß wir uns bildlich genau im Juli 1921
befinden. Im Artikel des Senftenberger Anzeigers ist ja von der direkten Nähe
zum Wasserturm die Rede und diesen kann man am oberen Bildrand erkennen.
|
|
Hierdurch gewitzigt, beschloß der Spritzenverband, seinen Spritzenpark durch
Anschaffung von zwei weiteren Motorspritzen und Verdoppelung des Schlauchmaterials
so zu vergrößern, daß er auch bei gleichzeitigen Bränden auf mehreren Werken
eingreifen konnte. Da die Motorspritzen fast immer auf die Tagebausohle herabgelassen
werden müssen, entschloß man sich, von den vierrädrigen Spritzen abzugehen und
leichtbeweglichere, zweirädrige Spritzen anzuschaffen, jedoch von möglichst
gleicher Leistung, wie die beiden ersten vierrädrigen.

Abseilen einer zweirädrigen Motorspritze in einen Tagebau
Diese von der Firma Flader in Jöhstadt i. Sa. gelieferten kleinen zweirädrigen
Motorspritzen, Normalleistung 1100 Liter bei 5 Atm., haben sich im Laufe der
Zeit derartig gut bewährt, daß auch eine ganze Reihe anderer Werke eine Spritze
dieser Firma sich anschaffte (Anhaltische Kohlenwerke, Grube Viktoria III,
Grube Meurostolln, Grube Waidmannsheil, Grube Hansa usw.).
Durch Anschaffung eines Schnellastkraftwagens (Magirus 1½-2 To.) ist der
Spritzenverband des Bergbauvereins augenblicklich in der Lage, sofort mit zwei
angehängten Spritzen und einigen 1000 Metern Schlauch einen Brand zu bekämpfen.
Das in den Motorspritzen- und Schlauchpark hineingesteckte Kapital von rund
85000 Mark hat sich im Laufe der Zeit bei den zahlreichen Bränden bestens rentiert,
den Werken größeren Produktionsausfall und der Belegschaft Lohnausfälle erspart.
|
|
Mit vier Motorspritzen, einem Schnellastkraftwagen und ca. 8000 Meter Schlauch
marschiert der Spritzenverband hinsichtlich seiner Feuerbekämpfungsmöglichkeit
an der Spitze im mitteldeutschen Braunkohlenbergbau.
Nun wird mancher berechtigt fragen: Wer bedient denn die Spritzen? Ursprünglich
auf die gesamte Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr Senftenberg angewiesen,
ging man später dazu über, einen besonderen Motorspritzenlöschzug beim Niederlausitzer
Bergbauverein e.V. zu bilden, der sich aus Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr
Senftenberg zusammensetzt und 28 Mann stark ist; für jede Motorspritze sieben Mann.
Der Führer dieses Motorspritzenlöschzuges, Brandmeister Schülke - Senftenberg, hat
es in jahrelanger unermüdlicher Tätigkeit verstanden, den Mannschaften des Zuges
eine derartig spezielle Ausbildung zuteil werden zu lassen, daß in jeder Hinsicht
ruhig behauptet werden kann: es ist nichts versäumt.
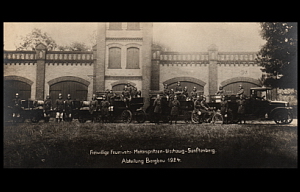
|
Aufnahme = 1924
Sammlung Matthias Gleisner
(Schenkung B.Neitzel)
|
Die vier Abteilungen des Motorspritzenlöschzuges, der seine kleidsame Dienstuniform
vom Spritzenverband erhielt, bestehen aus je einem Maschinisten, je drei Strahlrohrführern
und je drei Mann Schlauchbedienung, während sich die Leitung aus dem Brandmeister,
seinem Stellvertreter und zwei stellvertretenden Führern zusammensetzt.
Es kann wohl unbedenklich behauptet werden, daß die Braunkohlenwerke der Niederlausitz
mit dem hier näher geschilderten modern ausgerüsteten Motorspritzenpark der
Spritzengemeinschaft beim Niederlausitzer Bergbauverein E.V. Senftenberg sowie mit
den auf einer ganzen Reihe von Werken in den letzten Jahren angeschafften Motorspritzen
und eigenen Werksfeuerwehren vollkommen gegen Grubenbrände gerüstet sind, auch wenn
sie, wie 1922, mit besonderer Heftigkeit und so zahlreich und gleichzeitig wie damals
auftreten sollten.
Doch nicht nur Feuer war und ist der Feind der Bergleute. Auch ungezügelte Wassermassen,
die sich wolkenbruchartig in die offene Grube ergiessen, riefen die wackeren Kameraden
der Feuerwehr auf den Plan. In solchen Fällen pumpten sie nicht das Wasser in die Grube
hinein, sondern hinaus. Die verwendete Technik war dieselbe! Ein weiterer
Bericht aus dem Niederlausitzer Braunkohlenbergmann liefert die textliche Untermalung.
Und auch diesmal ist wieder von "Meurostolln" die Rede...
|
|
|
Verhängnisvolle Folgen von wolkenbruchartigem Gewitterregen im Braunkohlenbergbau
Von Diplom-Ingenieur Steffens, Niederl. Bergb.-Verein E.V. in "Der Niederlausitzer Braunkohlenbergmann" (1926)
|
Kaum sind die aus allen Teilen unseres Reviers einlaufenden Nachrichten über das
Hochwasser sämtlicher Flußläufe und die hierdurch verursachten Ueberschwemmungsschäden
vorüber, als von neuem Unheil berichtet werden muß. Durch das mit elementarischer
Gewalt am 5. Juli eintretende Gewitter mit wolkenbruchartigem Regen ist nicht nur
ein großer Stadtteil von Senftenberg II schwer heimgesucht worden, sondern es wurde
vor allen Dingen auch der Abraumbetrieb, der für die beiden Gruben "Meurostolln" und
"Elisabethglück" gemeinsam die für die Fabriken nötige Kohle liefert, ganz besonders
schwer von dem Unwetter heimgesucht.
Am Abend des 5. Juli vermochten durch die gewaltigen herniedergehenden Wassermengen
die Klärbassins den ungeheuer großen Wasserzulauf nicht mehr zu fassen, trotzdem sie
erst in großem Ausmaße vor kurzem ganz modern angelegt waren. Gewaltige Wassermengen
brachen über den Rand des Bassins und stürzten, alles mit sich reißend, auf die Sohle
des Tagebaues und von dort in einen mehrere hundert Meter langen Wasserhaltungsstollen,
in dem eine größere Pumpstation mit Maschinenraum vorhanden war. Während es einem
Teil der mit der Wasserhaltung beschäftigten Belegschaft gelang, sich in Sicherheit zu
bringen, war es zwei Mann der Bedienungsmannschaft in dem eben genannten Maschinenraum
wegen der Länge des Weges nicht mehr möglich, das Freie zu gewinnen, da der Stollen
außerdem in kurzer Zeit bis unter die Firste unter Wasser stand. Sofort ging die
Werksleitung daran, die zum Teil ersoffene Wasserhaltung wieder in Betrieb zu nehmen
und vor allem die in Not befindlichen Kameraden zu befreien. Die Verbindung mit
letzteren ließ allerdings nicht ab, da es möglich war, durch ein zirka 70 Meter tiefes
Bohrloch ihnen Nahrungsmittel und Nachrichten zukommen zu lassen.
Zunächst wurde die Motorspritze der Grube "Meurostolln" und daraufhin in den ersten
Vormittagsstunden des 6. Juli zwei Spritzen der Spritzengemeinschaft des Niederlausitzer
Bergbauvereins in Tätigkeit gesetzt, denen es wenigstens gelang, den Wasserspiegel zu
halten. Naturgemäß war, da diese drei Spritzen nur 3½ Kubikmeter in der Minute
leisten konnten, an eine Sümpfung des Stollens nicht zu denken, und so ging die
Werksleitung dazu über, während in der Zwischenzeit ein Damm vor dem Stollen aufgeschüttet
war zur Vermeidung weiterer Wassereinbrüche aus dem Tagebau in den Stollen, eine
Pumpe zur Verstärkung der Spritzen aufzustellen. Durch ununterbrochenen Pumpenbetrieb
gelang es, den Stollen soweit zu sümpfen und die Wasser- und die Pumpstation soweit
freizumachen, daß die dort eingeschlossenen beiden Pumpenwärter, die zu den ältesten
Belegschaftsmitgliedern der Grube "Meurostolln" gehören, in der Nacht des 6. Juli
wieder ans Tageslicht gelangen konnten.
Aus vorstehendem kurzen Bericht, der keineswegs die Vorgänge erschöpfend wiedergeben
kann, ist wiederum deutlich ersichtlich, wie wenig mennschliche Erfindungen, Maschinen
usw. zunächst imstande sind, Naturgewalten, wie sie in letzter Zeit durch häufige
wolkenbruchartige Regenmassen in die Erscheinung getreten sind, zu bekämpfen, und wie
überaus schnell im Bergbau Gefährdungen des Betriebes und Menschenleben eintreten
können. Gegen Naturgewalten ist der Mensch nach wie vor, wenigstens zunächst, hilflos.
|
|
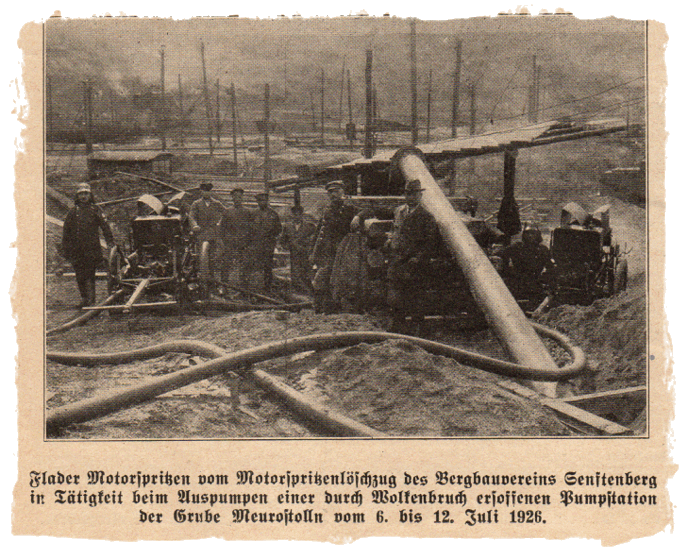 Aufgrund des obigen Faksimiles aus dem Niederlausitzer Braunkohlenbergmann können
wir nachfolgende Fotopostkarte nicht nur sehr gut datieren. Nein, es gelingt uns in
gewisser Weise sogar die Ansicht halbwegs zu verorten. Etwas, das bei diesen Tagebau-
Motiven in der Regel schwer bis unmöglich ist. Auf beiden Abbildungen ist nämlich die
selbe Pumpstation zu sehen. Nur aus gegenüberliegenden Perspektiven. Selbst die
abgebildeten Personen stimmen überein!
Aufgrund des obigen Faksimiles aus dem Niederlausitzer Braunkohlenbergmann können
wir nachfolgende Fotopostkarte nicht nur sehr gut datieren. Nein, es gelingt uns in
gewisser Weise sogar die Ansicht halbwegs zu verorten. Etwas, das bei diesen Tagebau-
Motiven in der Regel schwer bis unmöglich ist. Auf beiden Abbildungen ist nämlich die
selbe Pumpstation zu sehen. Nur aus gegenüberliegenden Perspektiven. Selbst die
abgebildeten Personen stimmen überein!

Aufnahme = 07.1926
Sammlung Fred Förster
Der Absender der Karte vermerkte im umseitigen Gruß an die Tochter Ilse in Leipzig:
Bei uns war große Überschwemmung (Wolkenbruch). Nachher Rutschung, die Karte ist hiervon.
Ob er persönlich abgebildet ist, geht aus dem vollständigen Text leider nicht hervor.
|
|